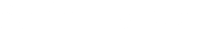„Es hätte nicht so kommen müssen!“ denke ich mir, und erinnere mich dabei unwillkürlich an die Worte meiner ersten Freundin, als es damals aus war – diesmal endgültig. Denn dass es nicht so hätte kommen müssen, ist natürlich gelogen, wie eigentlich immer, wenn Sprache im Spiel ist. Tatsächlich hätte es gar nicht anders kommen können: Sprache und ich, wir sind wie für einander geschaffen. Also, als Todfeinde. Das ist so angelegt. Aber es ist nicht meine Schuld – es ist die Schuld der Sprache.
Die Sprache ist ein Tyrann. Wer behauptet, sie zu beherrschen, verkennt die Umstände: Es ist die Sprache, die uns beherrscht. Mit parasitärem Elan bohrt sie Gedankengänge in unsere Gehirne und gibt dabei vor, eine Fertigkeit zu sein – aber auch das ist gelogen, wie fast alles in meinem Leben eine Lüge ist, seit ich mich mit Sprache infiziert habe.
Wäre die Sprache eine Fertigkeit, hätten wir die Wahl. Doch die Wahl hatte ich nie. Als sie in mein Leben trat, konnte ich nicht „nein“ sagen. Meinen Eltern unterstelle ich Vorsatz – so wie damals, als sie mich absichtlich zu meinen Geschwistern steckten, als diese Röteln bekamen, einfach um es hinter sich zu bringen. Die Röteln wurde ich wieder los. Die Sprache nicht.
Sprache vergiftet unsere Wahrnehmung. Wo sie gedeiht, zerfällt die Welt in ein kleinliches System aus Schubladen und Kategorisierungen. Indem wir uns Worte aneignen, müssen wir auch die mit ihnen verbundenen Gefühlswelten anwenden – emotional-geistige Fertigteile, denen wir uns nie wieder entziehen können.
Um mir Luft zu verschaffen, reise ich in ferne Länder, in denen meine Sprache keine Macht über mich hat. Kuraufenthalte sind das, die mich an immer exotischere Destinationen führen: Russland, China, Indonesien, Neukölln. Was andere dort für Sprache halten, ist Musik in meinen Ohren.
Von dem ungehobelten Kerl, der mich scheinbar grundlos anschnauzt, verstehe ich alles Wesentliche: Sein Wortschwall kommt über mich wie Regen aus einer Wolke, die sich an einem Berghang ausweint, doch die Rationalisierungen sind verloren, in den Spalt gefallen zwischen seiner Sprache und der meinigen.
Die Durchsage in der U-Bahn-Station baut auf mein Verständnis und leitet daraus Gehorsam ab. Nur: Ich verstehe nichts. Widerstand zwecklos, da unnötig – die Stimme gleitet sanft an mir ab und lässt den Wunsch nach Unterwerfung ungestillt zurück.
Riesige Werbeplakate brüllen mir meine Unvollkommenheit schon von weitem entgegen. Als ob Konsum die Lösung wäre! Weil ich jedoch nicht begreife, was zu konsumieren wäre, darf ich unvollkommen bleiben.
Ich höre die Gespräche der anderen und habe nach einer Weile das Gefühl zu verstehen – mehr zu verstehen als zu Hause, vielleicht sogar mehr als die Sprechenden selbst. Ich habe Zeit, in den Gesichtern zu lesen, und nehme den Rhythmus der Sprache wahr. Ich lausche ihrer Melodie und spüre intuitiv, ob es sich um eine Komposition des Wohlwollens handelt oder eine Symphonie der Missachtung, ob sie voll ansteckender Heiterkeit steckt oder nichts weiter ist als ein wortgewandtes Requiem.
Wer sich regelmäßig auf Kur begibt, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sprache überbewertet wird. Wenn ich zum Bäcker gehe, muss mir der Bäcker nicht sagen, dass das Brot frisch ist, denn dass es frisch ist, kann ich riechen. Der Bäcker muss mir aber auch nicht sagen, dass das alte Brot frisch ist, denn dass es alt ist, kann ich schmecken.
Ein einfaches Lächeln in Kombination mit ein paar Gesten deckt das Wesentliche ab. Für den persönlichen Ausdruck genügt ein Katalog des Brabbelns – einfache Lautfolgen, zwischen denen Gefühle Platz haben. So plappere ich vor mich hin wie früher – frei in meinem Empfinden wie vor der Zeit, als ich an Sprache erkrankte.
Lange habe ich mich gefragt, warum es Menschen gibt, die zehn Jahre in einem fremden Land leben und nie die Sprache lernen. Nun macht es Sinn.
Doch die Sprachbarriere hält nicht ewig: Früher oder später infiziert sich jeder. Eine Heimat kann es unter diesen Umständen fast nicht geben. Und so ist man immer auf der Flucht.
Ich müsste lügen – schon wieder lügen – wenn ich sagen würde, dass ich die Dinge nicht von Anfang an kommen gesehen habe: Sprache ist ein Instrument der Kontrolle. Wir verstehen um zu gehorchen. Wir sprechen um zu gestehen.
Alles andere ist nur Beifang. – Alles andere, das kommt erst später.
Ich klebe das Etikett “Frieden” auf die Toten, und das Etikett „Liebe“ auf meine Verachtung. Auf meine Ausbeutung schreibe ich „sozial“, und aus meinen Sklaven mache ich „Beschäftigte“. Meine industriellen Fleischabfälle nenne ich „Landwurst“ und meinen Wucher „günstig“. Meine Aggression entfache ich im Namen des Selbstschutzes und meine Unterdrückung im Namen der Freiheit.
Nachdem ich die Welt auf diese Art etikettiert habe, lehne ich mich zurück und betrachte die Etiketten der anderen. Was mir daran nicht passt, nenne ich „Missbrauch“. Ich behaupte, damit ein Stück Wahrheit entdeckt zu haben, und betone, dass es sich um schockierende Ausnahmen handelt und nicht etwa um den bestimmungsgemäßen Gebrauch von Sprache.
Was sich unter den Etiketten befindet, habe ich längst vergessen, doch werde ich den Verdacht nicht los, dass es etwas ist, das man mit den Sinnen wahrnehmen kann – etwas, das mit Fühlen zu tun hat.
Ich. Liebe. Dich.
Wie oft habe ich diese Worte schon gesagt? Und wie oft gehört? Wie oft haben sie gestimmt? Wie oft haben sie vielleicht teilweise gestimmt, dienten jedoch nicht dem Ausdruck einer Teil-Wahrheit, sondern der Verschleierung einer Teil-Lüge? Wie oft haben sie zwar gestimmt, dienten aber nicht der Wahrheit, sondern der Manipulation des Gegenübers?
Wahrheit braucht die Sprache nicht – solange uns die Worte fehlen, ist die Wahrheit in Sicherheit. Es ist die Lüge, die auf Sprache angewiesen ist.
Wir flüchten uns in Sprache, um jene Leere zu füllen, die der Verrat an unserer eigenen Wahrnehmung hinterlassen hat – eine Leere, die es doch nur gibt, weil wir gelernt haben, unseren Gefühlen zu misstrauen und uns auf Worte zu verlassen. So steht denn die Sprache zwischen uns und dem, was von unseren Gefühlen übrig ist.
Indem ich schreibe, versuche ich mich durch die Sprache zu graben, die mich von meinen Gefühlen trennt. Schreiben ist insofern eine Form des Scheiterns, ein Hängenbleiben, ein Nicht-Überwinden von Sprache. Wer die Sprache überwunden hat, kann damit aufhören.
Ich greife nach dem ersten Wort und stelle entsetzt fest, dass es nicht trägt, obwohl es doch eigentlich das richtige ist – ich schnappe in Panik nach immer anderen Worten, doch sie ziehen mich in die Tiefe. Ich lasse los, beginne zu strampeln, schlucke die ersten Buchstaben, Dunkelheit umgibt mich, Todesangst – ich komme wieder nach oben, ich weiß nicht wie, ich durchstoße die Oberfläche und japse nach Luft, ich rudere mit meinen Armen, greife nach immer mehr Worten, raffe zusammen was ich fassen kann, forme Flöße aus Sätzen, und Rettungsinseln aus Absätzen, ein ganzes Schiff aus Sprache, hieve mich hinein mit letzter Kraft – und kentere Augenblicke später.
Schriftsteller wird man nicht aus Talent – Schriftsteller wird man aus Unvermögen.