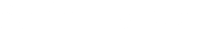Die Gentrifizierung erkennt man an der Ampel.
Wenn das grüne Signallicht unvermittelt auf Rot springt und ihr gehorsam in die Fahrradbremsen greift, ist die Zeit gekommen: Während sich eure mit Reflektoren gespickten Drahtesel grundlos stauen, fange ich an, in den Wohnungsanzeigen zu blättern. Während ihr die Warnwesten anlegt, ziehe ich den Mantel an, und während ihr die Helme aufsetzt, nehme ich den Hut.
Meine Freunde, die Amok fahrenden Radler von einst, sind längst verschwunden, wie Vögel in den Süden gezogen und von dort nie zurückgekehrt. Niemand mehr da, der Autofahrern den Stinkefinger zeigt, keiner, der dröhnend “Du Arschloch!” ruft, und auch das schallende “Fick dich!”, in diesen Straßen einst heimisch, ist längst verstummt. Keiner, der sie aus ihren verdammten Blechkisten zerrt und einmal so richtig vermöbelt, um sie daran zu erinnern, dass auch sie nur sterblich sind.
Da steht ihr nun in euren lächerlichen Warnwesten und huldigt einem roten Licht.
Um die nächste Ampel bei grün zu erwischen, schalte ich einen Gang höher. Auf eure Trolleys und Kinderwägen kann ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen, und für jeden, dessen letzter Blick beim Überqueren meiner Radspur seiner bescheuerten Facebook-App galt, mache ich eine Kerbe in meine Lenkstange.
Die Straßen sind gefährlich geworden in dieser Gegend. Kein Wunder, dass man da Warnwesten braucht.
Und die Angst? Ihr habt sie mitgebracht in euren Trolleys und Köfferchen, fein säuberlich gestapelt zwischen den Hemden und den Hosen und den Socken, zusammen mit dem Gehorsam, als ihr ausgezogen seid, die große Freiheit zu suchen.
Beim Auspacken ging jedoch etwas schief: Die Socken liegen jetzt im Schrank, aber eure Ängste, die sind da draußen. Sie warten auf euch, irgendwo in der Dunkelheit, und ihr schreit, schreit um Hilfe, weil ihr euch nicht sicher fühlt, nicht sicher in meiner Nachbarschaft.
Also ruft ihr die Polizei. Weil ihr es könnt. Wegen dem Dreck, der früher einmal Buntheit hieß, und diesem unerträglichen Lärm, den man vor kurzem noch für Musik hielt.
Ihr bezahlt sie ja, die Polizei, also soll sie etwas tun gegen eure Sorgen. Sie gibt sich auch alle Mühe, die Polizei, fahndet nach dem Grund für eure Ängste, kann ihn jedoch nicht finden, findet immer bloß Menschen, Menschen mit ganz anderen Sorgen und Ängsten, die sie kontrolliert und bedrängt und verweist und straft. Doch eure Ängste haben sie nicht – noch nicht.
Wie geblendet taumelt ihr durch meine Straßen – lauft an mir vorbei, als ob ihr nicht da wärt, und durch mich durch, als ob ich nicht da wäre.
Ich verstehe das. Ich will auch nicht hier sein. Hier, wo eure Ängste wohnen. Doch ich muss bleiben. Woanders wart ihr schon. Woanders kann sich keiner mehr das Leben leisten.
Den Klamotten sind jetzt Labels gewachsen. Die Stadt weicht ihrer Nachbildung. Den Doppelgänger erkennt man am Preis. Selbstdarstellung ist das neue Atmen – kein Atemzug ohne Statement, ohne sich auszudrücken, nochmals auszudrücken und immer wieder auszudrücken, bis nichts mehr bleibt als totale Leere.
“Wollt ihr den totalen Quatsch?” rufe ich euch zu.
“Totally like!” schallt es im Chor.
So führt ihr euren Kreuzzug gegen das so unerträgliche Schweigen. Einatmen: Totally. Ausatmen: Like. Einatmen: Totally. Ausatmen: Like. Einatmen: Totally. Ausatmen: Like. Worte in Endlosschleifen, Gespräche und doch keine, wie zwischen Anrufbeantwortern – Ansage auf Ansage, aber nie geht einer ran. Satz für Satz höhlt ihr aus, was früher mal dem Austausch diente. Ein geistig-seelisches Entkernen ist das – es geht dem Totalabriss voran.
Das Wochenende bringt Verstärkung. In Horden geht es durch die Straßen. Galeerensträflinge auf Landurlaub: Grölen, saufen, ficken, plündern. Urlaub von euch selbst: Wer könnte es euch verdenken? Das Vergnügen ein Geschöpf der Nacht – je trostloser das Dasein, umso größer der Spaß. Doch kein Gefängnisausbruch währt ewig: Wenn am Horizont der Alltag graut, kehrt ihr zurück in eure Verliese.
So zelebriert ihr den Wiederholungszwang vor meiner Haustür: Erst sind eure Seelen gestorben. Nun stirbt meine Nachbarschaft.
Am Ende ist das Geld. Wie ein tödlicher Schleier legt es sich über die Stadt. Wer es hat, gibt es aus, zahlt höhere Mieten, mehr für den Kaffee und mehr für das Bier, mehr beim Späti und mehr an der Wurstbude, die jetzt jedoch nicht mehr „Wurstbude“ heißt sondern „Curry Lounge 99“, das klingt doch auch viel besser. Der Fraß ist noch immer derselbe.
Warum?
Weil wir es uns leisten können!
Weil wir es uns wert sind.
Und weil wir nichts wert sind, wenn wir es uns nicht leisten können.
Ihr zahlt, weil ihr es könnt, und weil die, die ausziehen müssen, es nicht können.
So scheidet euch das Geld nun endlich von euren Ängsten. Sie gehören jetzt denen, die sonst nichts haben.
Ihr winkt den niedlichen Eingeborenen zum Abschied und wünscht ihnen alles Gute, während sie davonziehen mit ihren gebrauchten Koffern und Trolleys, die nackte Existenzangst im Gepäck.
Geld ist das Licht. Ihr leuchtet damit in die dunkelsten Ecken und scheucht auf, was ihr für Ungeziefer haltet. Am Geld habt ihr es erkannt, und mit Geld werdet ihr es bekämpfen. Geld ist euer Messer – es tötet, was euch Angst macht.
In unserem Kiez basteln wir jetzt Ampeln.
Wir hängen sie an die Äste der Bäume und schrauben sie an die Wände der Häuser. Wir stellen sie in Parks, montieren sie vor Kneipen und Bars und verbarrikadieren mit ihnen unsere Türen.
Unsere Ampeln sprechen eure Sprache.
Unsere Ampeln können kein Grün.
Mit unseren Ampeln halten wir euch auf.